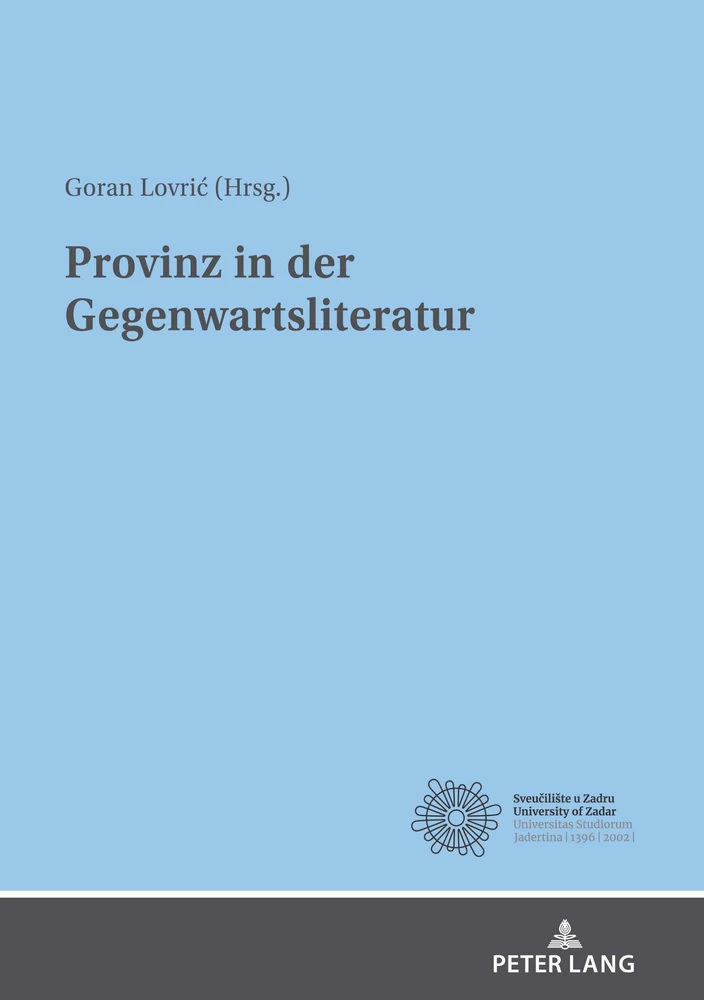Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „[W]as sich im Dorf gehör[t].“ Das Dorf als Figuration von ‚Provinz‘ in Romandebüts österreichischer Gegenwartsautorinnen und -autoren. (Ursula Klingenböck)
- In der Provinz ticken die Uhren anders. Zeitdarstellung in Raphaela Edelbauers Das flüssige Land (Goran Lovrić)
- Im Klitschentheater. Kolportage, Konjektur und Provinz in Andreas Maiers Südtirol-Roman Klausen (Paul Whitehead)
- Die Provinz in Maja Haderlaps Roman Engel des Vergessens als Mnemotop einer Familie und Nation (Marijana Jeleč)
- Die Provinz als Nicht-Ort. Zur Rekonfiguration des ländlichen Raums bei Reinhard Kaiser-Mühlecker (Viktoria Lehner)
- Is there anybody out there? Provinz als Schreibraum von Gewalt in Ulrike Almut Sandigs Monster wie wir und Stephan Roiss’ Triceratops (Friederike Ehwald)
- Habitus der Provinz – Realistische Narrative zwischen Fiktion, Region und Nostalgie (Elisa Garrett)
- Dorfgeschichte als Kulturgeschichte. Saša Stanišićs Dorfroman Vor dem Fest aus gattungsspezifischer Sicht (Marijana Erstić)
- (Nach-)Kriegs- und Stadtflüchtlinge in der Provinz. Ländlichkeit, Dörflichkeit und der Blick der Marginalisierten in Dörte Hansens Roman Altes Land (Willi Wolfgang Barthold)
- „Das Dorf war überall“. Zur Konvergenz von Kiez- und Provinzliteratur in Jan Brandts Gegen die Welt und Ein Haus auf dem Land/ Eine Wohnung in der Stadt (Sara Maatz)
- Sprachformen der Annäherung. Orte und Fahrten in Stephan Thomes Grenzgang (Gregor Kanitz)
- Wolfszeit in der Provinz. Gianna Molinaris Debütroman Hier ist noch alles möglich (Alexandra Ludewig)
- „Sie sagten Banat. Und sie hätten Atlantis sagen können, Wunderland, Mittelerde“. Zur literarischen Darstellung der banatischen Provinz im Werk von Nadine Schneider und Iris Wolff (Elin Nesje Vestli)
- Die Provinz in der modernen ungarndeutschen Literatur (Gábor Kerekes)
- Angaben zu den Autorinnen und Autoren
Einleitung
Der vorliegende Sammelband versammelt Beiträge zum Thema Provinz in der Gegenwartsliteratur, was eines der Themenfelder ist, von denen die deutschsprachige Literatur seit der Jahrtausendwende bis heute in auffallender Weise geprägt wird. Darüber zeugen auch zahlreiche literarische Preise, die in den letzten Jahren an Romane, in denen die Provinz im Mittelpunkt steht, verliehen wurden.
In den Beiträgen wird unter anderem untersucht, was den Begriff Provinz in der Gegenwartsliteratur ausmacht beziehungsweise auf welche Weise das Regionale und Ländliche dargestellt wird und wie aktuelle gesellschaftliche und politische Probleme und Phänomene thematisiert werden. Analysiert wird auch, ob Provinz geografisch wie in der traditionellen Regionalliteratur mit Land, Dorf oder Kleinstadt umschreiben werden kann oder ob diese Begriffe angesichts der Globalisierung und anderer gesellschaftlicher Veränderungen in der Gegenwartsliteratur andere Formen angenommen haben.
Der Sammelband ist thematisch eingeteilt in drei Teile, die sich auf geografischen Aspekten hinsichtlich der Herkunft der Autorinnen und Autoren und dem Inhalt der bearbeiteten Werke gründen, was sich in den ersten sechs Beiträgen hauptsächlich auf Österreich bezieht.
Im einführenden Beitrag „‚[W]as sich im Dorf gehör[t].‘ Das Dorf als Figuration von ‚Provinz‘ in Romandebüts österreichischer Gegenwartsautorinnen und -autoren“ befasst sich Ursula Klingenböck mit Debütromanen österreichischer Gegenwartsautorinnen und -autoren, in denen die konkrete, abstrakte und universelle „Dörflichkeit“ thematisiert wird. In den bearbeiteten Werken wird ein traditionelles und regressives Bild des Dorfes entworfen, das über komische, ironische und surreale Verfahren gebrochen und für ein modellhaftes Erzählen funktionalisiert wird. Gegenstand der zeitkritischen Darstellung und Reflexion sind sowohl dorfspezifische als auch allgemeine gesellschaftliche Phänomene und Probleme.
Im Aufsatz „In der Provinz ticken die Uhren anders. Zeitdarstellung in Raphaela Edelbauers Das flüssige Land“ analysiert Goran Lovrić die zum großen Teil surreale Handlung von Edelbauers Debütroman aus dem Jahr 2019, die im fiktiven Ort Groß-Einland in der österreichischen Provinz spielt. Die Analyse konzentriert sich auf der Zeitdarstellung im Roman, die ein Bestandteil der metaphorischen Handlung des Romans ist und die sich auf kosmologischen Theorien gründet. Groß-Einland und seine Einwohner sind eine Parabel ←7 | 8→auf die mangelnde Vergangenheitsbewältigung in der Nachkriegszeit, während die Provinz als fiktionaler Mikrokosmos erscheint, in dem Probleme und Zweifel des ganzen Landes kritisch hinterfragt werden.
Paul Whitehead befasst sich in seinem Beitrag „Im Klitschentheater. Kolportage, Konjektur und Provinz in Andreas Maiers Südtirol-Roman Klausen“ mit Maiers 2002 erschienenem Roman, in dem die Konfrontation von Fortschrittsgläubigen und Fortschrittskritikern, von Wirtschaftsverbänden und Naturschützern sowie von der lokalen lombardischen Bevölkerung mit Ausländern in der Südtiroler Provinz thematisiert wird. In den ironisch dargelegten Gesprächen der Dorfbevölkerung wird ihre Hilflosigkeit inszeniert, da sie sich wegen des ständigen Rauschens der Brennerautobahn kaum verständigen können und die Kommunikation so zu einer Farce gerät. Die Provinz wird im Roman aber nicht nur als Transitregion, die unter Globalisierungsmechanismen leidet, dargestellt sondern auch als Inszenierungsort zentraler zeitgenössischer Diskurse.
Im Beitrag „Die Provinz in Maja Haderlaps Roman Engel des Vergessens als Mnemotop einer Familie und Nation“ untersucht Marijana Jeleč die Raum-Zeit-Semantisierung in Maja Haderlaps 2011 veröffentlichten Roman. Ausgehend von Michael M. Bachtins Konzept der Untrennbarkeit der Komponenten Raum und Zeit in der Literatur und Aleida Assmanns Konzept der Erinnerungs- bzw. Gedächtnisorte wird in Engel des Vergessens nachgespürt, wie diese beiden Komponenten in Beziehung gesetzt werden, welche Bedeutung und Funktion dem dargestellten ländlichen Raum zukommt und wie sich dieser auf die Figuren auswirkt. Der Beitrag nähert sich dieser Fragestellung an, indem er die literarische Konstruktion von Raum, die Stadt-Land-Differenz sowie die Rekonstruktion der Vergangenheit beleuchtet.
Viktoria Lehner befasst sich im Aufsatz „Die Provinz als Nicht-Ort. Zur Rekonfiguration des ländlichen Raums bei Reinhard Kaiser-Mühlecker“ mit Werken des Autors, in denen er sich mit seiner Heimat, der oberösterreichischen Provinz, auseinandersetzt. Die Provinz wird als karger, einsamer und sinnentleerter Ort dargestellt, der durch Enteignungen und die Errichtung von Neubausiedlungen einem unaufhaltsamen Wandel unterzogen ist. Innerhalb des Spannungsfeldes von „Provinz“ und „Literatur“ wird demzufolge untersucht, ob ein substituierendes Element, das den sinnentleerten Raum zu füllen vermag, vorhanden ist. Für die Analyse und Interpretation der Texte Kaiser-Mühleckers wird Marc Augés Konzept der Nicht-Orte (‚non-lieux‘) bzw. Merkmale von Nicht-Orten zur Untersuchung der literarischen Raumkonstruktionen genutzt.
←8 | 9→Im Beitrag „Is there anybody out there? Provinz als Schreibraum von Gewalt in Ulrike Almut Sandigs Monster wie wir und Stephan Roiss’ Triceratops“ bearbeitet Friederike Ehwald zwei im Jahr 2020 erschienene Romane einer deutschen Autorin und eines österreichischen Autors, in denen Gewaltdarstellungen und Bedrohung offensichtlich und subtil zum Vorschein kommen und in direkter Verbindung mit Naturbeschreibungen und Sinneseindrücken stehen. Die Analyse zeigt die Verknüpfung struktureller Einengung auf dem Land und narrativer Enge in dysfunktionalen Familienstrukturen, wobei Provinz in den Romanen als Denkfigur einer Schwelle hin zur Gewalt fungiert. Liminale Zustände der Unbestimmtheit finden sich in beiden Romanen auf räumlicher, narrativer und psychischer Ebene.
Der thematisch zweite Teil des Sammelbands umfasst fünf Beiträge, die sich hauptsächlich mit deutschen Autoren und Gebieten befassen.
In ihrem Aufsatz „Habitus der Provinz – Realistische Narrative zwischen Fiktion, Region und Nostalgie“ untersucht Elisa Garrett regionale Literatur, die an spezielle Struktur- und Verhaltensmuster gebunden ist und einen bestimmten Habitus aufgreift sowie Authentizität vermittelt. Gleichzeitig weist die erzählte Provinz Unterschiede zur Wirklichkeit auf, indem fiktive Orte erstellt und in die reale Welt integriert werden. Die Provinz wird dabei durch die Handlung, das lokale Setting oder veränderte Stereotypen zugleich realistisch erzählt und fiktional überformt. Im Beitrag wird der Habitus der Provinz in Bezug auf Fiktionalität, Regionalität und narrative Zeitstruktur untersucht. Die literaturwissenschaftliche Analyse wird damit um einen kulturpoetischen Ansatz ergänzt, der dem Provinzroman ein besonderes Verhältnis zur Wirklichkeit zuspricht.
Marijana Erstić analysiert im Beitrag „Dorfgeschichte als Kulturgeschichte. Saša Stanišićs Dorfroman Vor dem Fest aus gattungsspezifischer Sicht“ Gattungselemente eines zeitgenössischen Dorfromans, für den Stanišić die Weichen stellt. Der Roman spielt in einem fiktionalen Dorf in der Uckermark und schildert die angespannte Stimmung vor dem traditionellen Dorffest. Die Spannung wird durch eine multiperspektivische Erzählposition erzeugt, wobei sich gleichzeitig Intertextualität und postmodernes Erzählen mit traditioneller Erzählweise abwechseln. Es wird auch untersucht, welche Gattungselemente der Autor benutzt und wo und wie er diese überschreitet und neukodiert. Es wird gezeigt, dass die Erzähltechnik dem geschilderten Ort immer wieder jene Öffnung und Vielschichtigkeit verleiht, die den Klischees der Provinz zuwiderläuft.
Im Beitrag „(Nach-)Kriegs- und Stadtflüchtlinge in der Provinz. Ländlichkeit, Dörflichkeit und der Blick der Marginalisierten in Dörte Hansens ←9 | 10→Roman Altes Land“ untersucht Willi Wolfgang Barthold wie neuere ‚Dorfgeschichten‘ die Vermischungs- und Austauschprozesse zwischen dem Ruralen und dem Urbanen in der Gegenwart fokussieren und Transformationsprozesse aus denormalisierter und selbstkritischer Perspektive beobachten, indem sie sich den Erfahrungen bisher marginalisierter Akteurinnen und Akteure widmen. Der Roman Altes Land überblendet dazu das gegenwärtige Phänomen der ‚Stadtflucht‘ mit dem Themenkomplex Flucht und Vertreibung und imaginiert siedlungsstrukturell übergreifende Formen der Vergesellschaftung im Sinne einer „Neuen Dörflichkeit“.
Sara Maatz hinterfragt im Aufsatz „‚Das Dorf war überall.‘ Zur Konvergenz von Kiez- und Provinzliteratur in Jan Brandts Gegen die Welt und Ein Haus auf dem Land/ Eine Wohnung in der Stadt“ die häufig postulierte Dichotomie von deutschsprachiger Stadt- und Dorfliteratur. Anhand der Analyse von Jan Brandts Texten wird die These einer Annäherung von urbanen und ruralen Narrativen vertreten, die ihren Ursprung in der fortschreitenden Urbanisierung nimmt. Diese Verflechtung mündet in ‚rurbanen‘ Literaturen, die sich im Fall von Jan Brandts Werken bewusst einer eindeutigen Gattungszuschreibung verweigern. Stattdessen inszenieren sich die Texte als Imaginationen eines ‚Dazwischen‘, das von räumlicher Mobilität und einer Suche nach Zugehörigkeit geprägt ist.
Im Aufsatz „Sprachformen der Annäherung. Orte und Fahrten in Stephan Thomes Grenzgang“ analysiert Gregor Kanitz den im Jahr 2009 erschienenen Roman von Stephan Thome, der teils als neues ‚Welttheater‘ oder Lebensutopie gefeiert wurde. Anhand von Marc Augés Raumtheorie als ‚operativer’ Möglichkeit der Inszenierung von Orten werden die Wege und Fahrten der beiden Protagonisten in ihren Wendungen und Sprachformen thematisiert, wobei als dritter Protagonist das Auto erscheint, das die gemächlichen Rituale des alle sieben Jahre gefeierten Grenzganges im hessischen Biedenkopf beschleunigt.
Im dritten Teil des Sammelbands folgen drei Beiträge, in denen unterschiedliche Länder und Regionen im Mittelpunkt stehen.
Alexandra Ludewig befasst sich im Beitrag „Wolfszeit in der Provinz. Gianna Molinaris Debütroman Hier ist noch alles möglich“ mit dem 2018 erschienenen Werk der Schweizer Autorin, in dem die Veränderung von Lebenswelten durch menschliche und nicht-menschliche Lebewesen thematisiert wird. Molinari zeigt eine starke Frauenfigur, die alternative Formen des Zusammenlebens und der Weltgestaltung verfolgt. Ihre Begegnungen mit männlichen Mitarbeitern, Migranten und dem Wolf lassen die Protagonistin über verschiedene Aspekte der Heimat nachdenken. Durch die ständige Bewegung von Menschen und Tieren ist sie gezwungen, ihr Zuhause physisch und ←10 | 11→psychisch immer wieder neu zu gestalten. Ludewig stützt sich auf ökofeministische Erkenntnisse, um die Interaktion zwischen der Protagonistin und allem, was die Gesellschaft unter ‚dem Wolf‘ subsumiert, zu analysieren.
Im Aufsatz „‚Sie sagten Banat. Und sie hätten Atlantis sagen können, Wunderland, Mittelerde‘. Zur literarischen Darstellung der banatischen Provinz im Werk von Nadine Schneider und Iris Wolff“ analysiert Elin Nesje Vestli in Nadine Schneiders Drei Kilometer und Iris Wolffs Die Unschärfe der Welt die Darstellung des Dorfes, das als reelle Lebenswirklichkeit und als eine ambivalente Struktur erscheint, in der gleichzeitig Traditionen und Auflehnung gegen dieselben innerhalb einer Diktatur verhandelt werden. Die als rückständig empfundene Provinz wird allerdings nicht nur als ein Raum der Enge und Fremdbestimmung entworfen, sondern auch als Erinnerungslandschaft und Sehnsuchtsort. Dabei entstehen literarische Topografien, in denen reelle Lebenswirklichkeit, historische Zäsuren und Erinnerungen zusammenkommen.
Gábor Kerekes zeigt im Beitrag „Die Provinz in der modernen ungarndeutschen Literatur“, dass die Provinz als Thema und Handlungsort in der ungarndeutschen Literatur eine besondere Rolle besitzt, da sich die ungarndeutschen Siedlungsgebiete Ungarns zumeist auf dem Land befinden. Insofern ist die literarische Provinz auch der Inbegriff von Frieden und Heimat. Als besonders wichtiges Element erscheint in den Texten die Bewahrung der Traditionen der deutschen Vorfahren. Zugleich ist eine widerspruchsvolle Eigenheit dieser Literatur, dass in diesem Kontext auf die Bedeutung der deutschen Muttersprache verwiesen wird, die Texte aber normalerweise das Standarddeutsche benutzen, also gerade die Variante des Deutschen, die am wenigsten mit der Provinz in Verbindung gebracht werden kann.
Die hier versammelten Beiträge zeigen, dass die Darstellung der Provinz in der Gegenwartsliteratur die sich ständig ändernden allgemeinen gesellschaftlichen Verhältnisse und Lebens- und Arbeitsbedingungen widerspiegelt. Dies bezieht sich einerseits auf die Vermischung zwischen Urbanem und Ruralem in Form von Urbanisierung und Stadtflucht, andererseits aber auch auf die Landflucht und Verödung der von wirtschaftlichen und kulturellen Zentren entfernterer Regionen. Die Provinz hat in der Gegenwartsliteratur ebenfalls die bereits traditionelle Rolle als Mikrokosmos inne, in dem sich globale und nationale Missstände widerspiegeln, was auch an Motiven wie Migration und Vergangenheitsbewältigung sichtbar wird. Die zeitgenössische Provinzliteratur verbindet demnach in narratologischer Hinsicht postmodernes und traditionelles Erzählen sowie auf inhaltlicher Ebene Rurales und Urbanes.
←11 | 12→Bemerkenswert ist auch, dass viele der im Sammelband bearbeiteten Werke Debütromane zumeist junger Autorinnen und Autoren sind. Das kann als Zeichen der stetigen Erneuerung der Gattung gedeutet werden, was auch dadurch bestätigt wird, dass aktuelle globale Phänomene wie die Migrationskrise und der Klimawandel Einzug in die Provinzliteratur gehalten haben. In dieser Hinsicht bleibt abzuwarten, ob und wie sich die aktuelle Corona-Pandemie als bislang dramatischster gesellschaftlicher und politischer Einschnitt dieses Jahrhunderts auf diese Gattung auswirken wird. Dieser Sammelband stellt auch in dieser Hinsicht eine Bestandsaufnahme der Provinzliteratur von Beginn des 21. Jhs. bis zu dieser weitreichenden Zäsur dar.
Zadar, Mai 2021 Goran Lovrić
Details
- Seiten
- 300
- Jahr
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631869451
- ISBN (ePUB)
- 9783631869468
- ISBN (Hardcover)
- 9783631855874
- DOI
- 10.3726/b19178
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (Oktober)
- Schlagworte
- Rurales Regionalliteratur Dorfroman Vergangenheitsbewältigung Migration Banat Ungarndeutsche Literarische Topografie Mnemotop Stadtflucht
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 300 S., 8 s/w Abb.