Leseprobe
Gliederung:
1. Einleitung
2. Biografien
2.1 Sokrates
2.2 Jesus
3. Vergleich
4. Hellenismus
4.1 Allgemeine Definition
4.2 Hellenismus und seine Auswirkungen
4.3 Die Philosophie in der Zeit des Hellenismus
4.3.1 Die Epikureer
4.3.2 Die Stoiker
4.4 Andere Stimmen zum Hellenismus (Anhang)
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Zwei große Männer in der Geschichte, die zu unterschiedlichen Zeiten gelebt haben, und doch werden sie miteinander verglichen: Sokrates und Jesus. Warum? Dieser Frage soll heute nachgegangen werden.
2. Biografien
2.1 Sokrates
Dass Sokrates mit Jesus verglichen wird, ist sicherlich schon vielen bekannt, ich werde hier versuchen diesem Mythos durch einem Vergleich auf den Leib zu rücken
„Zauberer von Athen“ (Alkibiades - Schüler des Sokrates)
„Den Sokrates zu loben, ihr Männer, will ich so versuchen: durch Bilder... Ich behaupte denn nun, dass er gänzlich ähnlich den Silenen ist, die da in den Bildhauerwerkstätten stehen, die die Künstler darstellen mit Schalmeien oder Flöten in den Händen und die, nach beiden Seiten hin aufgeklappt, im Inneren vorhandene Götterbilder sichtbar werden lassen. Und ich behaupte weiter, dass er dem Satyr Marsyas (Satyrn: Gestalten der griechischen Mythologie; Feld-, Wald- und Fruchtbarkeitsdämonen, die zechend und berauscht durch die Natur streifen und den Nymphen nachstellen) gleicht. Dass du nun wenigstens dem Aussehen nach diesen Gestalten ähnlich bist, Sokrates, dürftest du nicht einmal selbst bestreiten. Dass du ihnen aber auch sonst gleichst, höre hiernach! Du bist ein Schalk! Oder nicht? Wenn du es nämlich nicht zugibst werde ich Zeugen dafür bringen. Doch kein Flötenspieler? Ein viel wunderlicher noch als jener! Er bezauberte ja über Instrumente die Menschen, durch die Kraft, die von seinem Munde ausging... Du aber unterscheidest dich von ihm nur dadurch, dass du ohne Instrumente, mit bloßen Worten ebendies bewirkst“ (Symp. 215 a - c).
- Sokrates: hässlich, satyrhaft, schlug Gesprächspartner in Bann, lähmte, rüttelte auf
„Zitteraal“ (Menon - Thessaler, kämpfte mit Sokrates gemeinsam - von Xenophon (Sokratiker) als ruchlos dargestellt) - nach dem Anfassen ist man wie betäubt, gelähmt, in Schrecken versetzt.
Leben
Sokrates ist der Sohn des Sophroniskos, einem Bildhauer, und der Phainarete, einer Hebamme. Seine Geburt wird auf die Zeit um 469 v. Chr. geschätzt. Sein Aufwachsen spielte sich im Athen des Perikles (*kurz nach 500 v. Chr.; starb 429 v. Chr.; athenischer Staatsmann - attischer Seebund, attisches Seereich - Perikleisches Zeitalter: Glanzzeit Athens + Blütezeit der bildenden Kunst, Dichtung, Philosophie) ab und hatte das Glück, mit großen Persönlichkeiten wie Sophokles (griechischer Tragiker), Pheidias (Seher) und Thukydides (Geschichtsschreiber) zu leben. Sophroniskos versuchte, seinem Sohn die bestmögliche Ausbildung zu geben, die in Athen möglich war. Eben dies ist daran zu erkennen, dass er sich oft auf Homer beruft, wenn er spricht. Es ist daher aber auch umstritten, ob er überhaupt schreiben konnte, denn alles, was wir über ihn erfahren, ist aus Werken von seinen Schülern (vor allem Platon). Er lernte den Beruf seines Vaters, bevor er sich als junger Steinmetz ganz der Philosophie verschrieb. Ironisch sagt er dazu sogar, dass er selbst einmal ein Schüler des Prodikos (eines Sophisten) war. Er war verheiratet mit der, heute fälschlicherweise für zänkische Frauen stehenden, Xanthippe. Beide hatten drei Söhne. Xanthippe ist dahingehend zu verstehen, dass sie nicht verstand, wieso sich ihr Mann, der doch eine ganze Familie zu versorgen hatte, lieber philosophischen Gesprächen auf der Strasse hingab, für die er noch nicht einmal Geld verlangte. Daher ist es auch logisch, dass seine
Lebensverhältnisse sehr ärmlich waren, er eigentlich knapp am Existenzminimum sein Dasein verrichtete. Seine Ideologie geht sogar soweit, dass er in den letzten Minuten seines Lebens seine Frau hinausführen lässt, um sich einem letzten philosophischen Disput widmen zu können, der folgendermaßen endet: „Crito, ich schulde Aesculapius etwas, vergiss es nicht zu bezahlen.“ (Platon, Phaidon) - „Crito“, he said, „I owe a cook to Aesculapius; do not forget to pay it.“
In Erfüllung seiner Pflicht als Bürger der Polis nahm er zu Beginn des Peloponnesischen Krieges (Auseinandersetzung Athens (+attischer Seebund) und Spartas 431 bis 404 - Kapitulation Athens) an den Kämpfen um Potidaia teil, wo er dem verwundeten Alkibiades Waffen und Leben rettete, weiterhin kämpfte er um Delion und Amphipolis.
Hier zeigt er, dass es ihm möglich ist in Zeiten schlimmsten Hungers zu überleben. Es ist seine robuste Natur und seine Ausdauer, die ihm die Kraft dazu geben.
Weiterhin zeichnete sich Sokrates durch einen sehr hohen Ethos dem Staat gegenüber aus. Er hatte sich nie um politische Ämter bemüht, kommt aber durch den Zuspruch einiger einflußreicher Menschen zum Amt des Prytanen. Hier zeigt er weiterhin seine klare Prinzipientreue, indem er sich in weiser Voraussicht nicht für Dinge einsetzt, die anderen, Unschuldigen schaden könnten.
Sokrates ging nach Delphi und bekommt auf die Frage, wer denn der Klügste sei die Antwort, dass er es sei. Dies ist ein Schlüsselerlebnis in seinem Leben. Er widmet sich nun voll und ganz seiner Aufgabe herauszufinden, ob es nun wirklich an dem ist, dass er der Klügste sei. Er macht sich also auf den Weg, auf die Strasse, um mit Menschen verschiedener Bevölkerungsgruppen zu sprechen (Handwerker, Politiker,. Dichter u. a.) und mit ihnen gemeinsam nach der Definition für Begriffe wie Tugend, das Gute etc. zu suchen. Dabei fragt er den Betreffenden nach seiner Definition und nimmt danach eben diese auseinander, hinterfragt jegliche Unklarheit. Meistens ruft er dadurch große Verwirrung hervor, denn durch dieses Hinterfragen macht er die Menschen auf ihre eigenen Fehler aufmerksam, und somit macht er sich diese Menschen zu seinen Feinden, aber manchmal ist er auch in der Lage zusammen mit der Person eine allgemeingültige Definition für einen Begriff zu finden, die dann wissenschaftlich begründet ist. Diese Methode nennt man dialektische Methode.
Sokrates spielt immer den Nichtwisenden, obwohl ein Gespräch eindeutig von ihm beherrscht wird. Wenn er sich mit seinen Mitmenschen unterhält gebraucht er meist einfache Begriffe, die für so gut wie jeden verständlich sind.
Man kann also feststellen, dass er der Wahrheit, wie eine Hebamme an das Licht geholfen hat (Verweis auf Beruf der Mutter) - wir nennen diese Technik Maieutik.
Sokrates, dieser penetrante Frager, der strenge Mahner, unerbittliche Gegner allen Scheinwissens, der bissige Ironiker lauter Spielarten dieses schwer zu begreifenden Mannes. Die Tradition hängt ihm etwas Kauziges an, dazu gehören auch einige Dispute mit der berüchtigten Xanthippe.
Die Tragik des Lebens des Sokrates ist in seinem scharfen Gegnertum zu den Sophisten zu finden, denn leider war dies den Bürgern Athens nicht bewusst, sie rechneten ihn zu den heuchlerischen und geldgierigen Sophisten, da beide den Mensch in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen stellten (anthropozentrische Problemstellungen) und beide auch ähnliche Taktiken anwendeten. Hier soll nun der Gegensatz aufgezeigt werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die sokratische Ironie hat helfende Absicht, will den Menschen befreien und für die Wahrheit öffnen, sie sucht und ist mit dem derzeitigen geistigen und sittlichen Zustand nicht einverstanden, ist widerspruchsvoll (Verwunderung). Sokrates selbst nimmt sich mit in eine Diskussion hinein, fragt selbst nach, macht sich keine Illusionen, ist leidenschaftlich. Die negative Seite dieser Ironie liegt in den verwandten Gefühlen dieser Verwunderung, nämlich in der Betroffenheit, der Empfindung des Seltsamen, Ungemäßen und Verzwickten, des Misstrauens. Besonders ist daran, dass diese Ironie, wie vielleicht naheliegend, nicht verspotten möchte, sondern gar zum Denken anregen will, suchen und fragen möchte. Sokrates selbst ist der Ironie ausgesetzt: Sein äußeres und sein Inneres sind nicht deckungsgleich (vgl. Zitat Alkibiades). Außerdem packt er alles in einen Satz, den Satz, der ihn von all seinen damaligen Mitmenschen abgehoben hat: „Ich weiß, daß ich nichts weiß“. Das ist es, was ihn bewundernswert und seiner Zeit voraus gesetzt hat, denn er war einen Schritt näher an der absoluten Wahrheit als die restliche Menge.
Dies alles brachte ihm nun nicht sehr große Beliebtheit von seinen Mitmenschen ein, sie brachten ihn vor Gericht und beschuldigten ihn, ihre Kinder zu verführen und nicht an die Götter zu glauben. Wir können seine Verteidigungsrede in Platons Apologie des Sokrates nachlesen. Auffallend daran ist, dass er nicht, wie es vielleicht viele andere getan hätten, seine Kinder und seine Frau mit zum Gericht bringt, um Mitleid zu erwirken, er ist sich sicher, im Recht zu sein und appelliert an den gesunden Menschenverstand der Bevölkerung. Er wird trotz alledem zum Tode verurteilt. Seine letzten Tage in seinem Leben sind wiederum bei Platon nachzulesen, im Phaidon. Hier möchte er nicht, dass ihn seine Freunde retten, er stellt sich seinem Schicksal und trinkt den wohlbekannten Schirlingsbecher.
Sokrates stirbt im Jahre 399 v. Chr..
Sokrates war im heutigen Sinne ein Revolutionär, er brachte die Philosophie vom Himmel (Thales) auf den Erde.
„Aber nun ist die Zeit gekommen und folglich müssen wir gehen; ich zum Sterben, und du zum Leben. Ob Leben oder Tod besser ist wissen nur die Götter, einzig und allein die Götter.“ (Platon, Phaidon).
2.2 Jesus
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Vergleich
Sokrates und Jesus haben in dem Sinne viel gemeinsam, dass sie ihrer Zeit voraus waren. Jesus mit der Botschaft Gottes im Gepäck und Sokrates mit seiner Wahrheits- und Weisheitslehre. Es waren sicherlich beide kluge Menschen, denn ansonsten hätten sie nie derartig viele Zuhörer gehabt. Man hat aber beide auch nicht verstanden, deshalb wurden sie auch hingerichtet durch die Hand der Menschen. Ihre Sprache war einfach - sie wollten verstanden werden. Sie waren selbstlos, beide nahmen nie Geld für ihre Lehren. Beide haben etwas ironisches an sich. Sokrates durch sein kauziges Aussehen, nicht einem großen Philosophen ähnlich. Bei Jesus erkennen wir es, als er mit einem Esel einreitet, also nicht wie es einem König würdig wäre. Weiterhin haben beide nie etwas schriftlich hinterlassen. Wir erfahren von ihnen durch ihre Anhänger oder unabhängige Zeitzeugen, demzufolge muss man differenzieren können zwischen Wirklichkeit und angedichteten, idealisierten Taten. Auffällig ist auch, dass beide keine Angst vor dem Tod zu haben scheinen. - Beiden wird der Prozess wegen Gotteslästerung gemacht.
Unterschiede sind folgende:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. Hellenismus (Gräzisierung)
4.1 Allgemeine Definition
Hat zwei Bedeutungen: Zum einen wird der Vorgang der Hellenisierung gemeint, zum anderen die Epoche der stärksten Ausbreitung und Annahme der griechischen Kultur (seit Alexander dem Großen (ca. 331 v. Chr.) bis zur römischen Kaiserzeit, etwa von 31 v. Chr.). So wurde also auch der gesamte Orient von der griechischen Kultur durchdrungen. Der Begriff leitet sich vom griechischen „Hellas“ für Griechenland her.
4.2 Hellenismus und seine Auswirkungen
Auf politischem Gebiet ging die Vormacht von Stadtstaaten, wie Athen, Theben oder Sparta auf Flächenstaaten, wie das Reich der Seleukiden in Vorderasien, der Ptolmäer in Ägypten und den Achäischen Bund in Griechenland über. Alexander der Große (Alexanderzüge, Alexanderreich) und seine Nachfolger siedelten Griechen in vielen, z. T. neu gegründeten Städten in Asien und Ägypten an. Dadurch verbreitete sich die griechische Sprache und Kultur auch in den östlichen Mittelmeergebieten. Aber auch umgekehrt drangen orientalische Religionen und wissenschaftliche Erkenntnisse in das griechische Geistesleben ein. Ca. 200 v. Chr. kam dieses Gedankengut auch nach Rom. So fand die griechische Sprache eine Ausdehnung von Spanien bis nach Indien, vom Kaspischen Meer bis zu den Nilschwellen. So sind Aristoteles und seine Schüler dahingehend zu nennen, dass sie zur Entwicklung von Einzelwissenschaften (Zoologie, Botanik...) im Zeitalter des Hellenismus beitrugen. Weiterhin beschäftigte man sich an neu gegründeten Bildungseinrichtungen (besonders hervorzuheben ist hier das Museion in Alexandria, der kulturelle Mittelpunkt der hellenistischen Welt) mit den Werken klassischer griechischer Schriftsteller (Homer, Euripides, Sophokles). Durch die sprachliche Einheit der Gelehrtenwelt wurde auch die Kommunikation auf wissenschaftlicher Basis einfacher, denn nun konnte man z. B. astronomische Beobachtungen von unterschiedlichen Standpunkten aus eingehender beleuchten.
Das Christentum entwickelte sich unter dem Einfluß des Hellenismus beim Übergang in die römische Zeit. Insofern bildet der Hellenismus den Kontext für ein zeitgeschichtliches Verständnis des Christentums. Man kann das besonders gut an der Sprache des Neuen Testamentes (Evangelium und Apostelbriefe), dem Griechischen, erkennen. Ohne die griechische Koine (Gemeinsprache) wäre also auch die Ausbreitung des Christentums nicht denkbar gewesen.
4.3. Philosophie in der Zeit des Hellenismus
Ursache für dies Lehren:
1. politische Bedeutungslosigkeit der griechischen Stadtstaaten
2. Sinnlosigkeit des Lebens vieler Bürger
Die Folge waren zwei, auf praktische Lebensbewältigung ausgerichtete Philosophenschulen:
4.3.1 Die Epikureer
Schule des Epikur aus Samos, der sich mit seinen Anhängern in einem Garten traf, um philosophische Gespräche zu führen (daher der Name der Schule „Kepos“). Er lehrte von einem apolitischen, abgeschiedenen Leben, dass nur auf das persönliche Vergnügen abzielte, da nur ein Leben im Freundeskreis zu wahrem Glücklichsein führe. Als Begründung führte er an, dass die Götter zwar existieren, diese aber keinen Einfluss auf den Menschen nähmen und ein Leben nach dem Tod nicht existiere. Beispiel dafür sei die Lehre des Demokrit von den Atomen.
4.3.2 Die Stoiker
Die entgegengesetzte Schule, die der Stoiker. Ihr Begründer ist Zenon von Kition (um 300 v. Chr. In Athen gegründet), der in der Stoa lehrte, dass jegliche Gemütsregung (Apathie) verwerflich sei und man somit unabdinglich ethischen Pflichten nachkommen müsse. Die Stoiker sahen eine ihrer wichtigsten Aufgaben darin, die einzelnen menschlichen Tugenden wie Tapferkeit, Gerechtigkeit, Besonnenheit, Einsicht neu zu definieren und in ihr System der Weltbetrachtung mit einzubeziehen. Sie meinten also, dass der Mensch nur dann richtig und vernunftsgemäß handelt, wenn er das ihm „Zukommende“ erkennt und tut. Sie entwickelten weiterhin das Ideal der „Weisen“, die die Weltordnung als natürlich und vernünftig anerkannt haben und deshalb von sich aus in Übereinstimmung mit der Natur zu leben versuchen. Alles, was gegen dies Ordnung ist, also auch Gefühle und Leidenschaften müssen beherrscht werden. Diese Philosophie fand später bei den Römern sehr großen Anklang.
5. Literaturverzeichnis
N.N.:
Duden Schülerlexikon.
Dudenverlag, Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich, 1994
N.N.:
Weltgeschichte Der synchronoptische Überblick.
Chronik Verlag im Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH, Gütersloh/München, 1997
Baldamus, A., Weber, G.:
Griechische Geschichte. Emil Vollmer Verlag
N.N.:
Kantharos.
Ernst Klett Schulbuchverlag, Stuttgart; Düsseldorf; Berlin; Leipzig, 1992
N.N.:
Discovery ’98 Das große Universallexikon.
Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH, Gütersloh, 1997
N.N.:
Religionslexikon.
Georg Bubholz Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co., Frankfurt a. M., 1990
Stamer, U.:
Abiturwissen Jesus Christus.
Ernst Klett Verlag, Stuttgart; Düseldorf; Leipzig, 1998
Platon:
Phaidon.
Platon:
Apologie des Sokrates.
N.N.:
http://lgxserver.uniba.it/lei/filmed/rec1.htm
N.N.:
http://www.geschichte.2me.net/bio/cethegus/j/jesus.jpg
Ein Vergleich: Sokrates und Jesus - Hellenisierung des Christentums
Sokrates:
Sokrates ist der Sohn des Sophroniskos, einem Bildhauer, und der Phainarete, einer Hebamme. Seine Geburt wird auf die Zeit um 469 v. Chr. geschätzt. Sein Aufwachsen spielte sich im Athen des Perikles ab. Er hatte das Glück mit großen Persönlichkeiten wie Sophokles (griechischer Tragiker), Pheidias (Seher) und Thukydides (Geschichtsschreiber) zu leben. Sokrates lernte den Beruf seines Vaters, bevor er sich als junger Steinmetz ganz der Philosophie verschrieb. Er war verheiratet mit der, heute fälschlicherweise für zänkische Frauen stehenden, Xanthippe. Beide hatten drei Söhne. Xanthippe ist dahingehend zu verstehen, dass sie nicht verstand, wieso sich ihr Mann, der doch eine ganze Familie zu versorgen hatte, lieber philosophischen Gesprächen auf der Strasse hingab, für die er noch nicht einmal Geld verlangte. Daher ist es auch logisch, dass seine Lebensverhältnisse sehr ärmlich waren.
Lehre:
Sokrates spielt immer den Nichtwisenden, obwohl ein Gespräch eindeutig von ihm beherrscht wird. Wenn er sich mit seinen Mitmenschen unterhält gebraucht er meist einfache Begriffe, die für so gut wie jeden verständlich sind. Man kann also feststellen, dass er der Wahrheit, wie eine Hebamme an das Licht geholfen hat (Verweis auf Beruf der Mutter) - wir nennen diese Technik Maieutik.
Sokrates, dieser penetrante Frager, der strenge Mahner, unerbittliche Gegner allen Scheinwissens, der bissige Ironiker, lauter Spielarten dieses schwer zu begreifenden Mannes.
Sokrates stirbt im Jahre 399 v. Chr..
Sokrates war im heutigen Sinne ein Revolutionär, er brachte die Philosophie vom Himmel (Thales) auf den Erde.
„Aber nun ist die Zeit gekommen und folglich müssen wir gehen; ich zum Sterben, und du zum Leben. Ob Leben oder Tod besser ist wissen nur die Götter, einzig und allein die Götter.“ (Platon, Phaidon).
Jesus:
siehe Religionshefter
Vergleich:
Gemeinsamkeiten
Sokrates und Jesus haben in dem Sinne viel gemeinsam, dass sie ihrer Zeit voraus waren. Jesus mit der Botschaft Gottes im Gepäck und Sokrates mit seiner Wahrheits- und Weisheitslehre. Es waren sicherlich beide kluge Menschen, denn ansonsten hätten sie nie derartig viele Zuhörer gehabt. Man hat aber beide nicht verstanden, deshalb wurden sie auch hingerichtet durch die Hand der Menschen. Ihre Sprache war einfach - sie wollten verstanden werden. Sie waren selbstlos, beide nahmen nie Geld für ihre Lehren. Beide haben etwas ironisches an sich. Sokrates durch sein kauziges Aussehen, nicht einem großen Philosophen ähnlich. Bei Jesus erkennen wir es, als er mit einem Esel einreitet, also nicht wie es einem König würdig wäre (bezogen auf sokratische Ironie). Weiterhin haben beide nie etwas schriftlich hinterlassen. Wir erfahren von ihnen durch ihre Anhänger oder unabhängige Zeitzeugen, demzufolge muss man differenzieren können zwischen Wirklichkeit und angedichteten, idealisierten Taten. Auffällig ist auch, dass beide keine Angst vor dem Tod zu haben scheinen. - Beiden wird der Prozess wegen Gotteslästerung gemacht.
Unterschiede
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hellenismus:
Hat zwei Bedeutungen: Zum einen wird der Vorgang der Hellenisierung gemeint, zum anderen die Epoche der stärksten Ausbreitung und Annahme der griechischen Kultur (seit Alexander dem Großen (ca. 331 v. Chr.) bis zur römischen Kaiserzeit, etwa von 31 v. Chr.).
Das Christentum entwickelte sich unter dem Einfluß des Hellenismus beim Übergang in die römische Zeit. Insofern bildet der Hellenismus den Kontext für ein zeitgeschichtliches Verständnis des Christentums. Man kann das besonders gut an der Sprache des Neuen Testamentes (Evangelium und Apostelbriefe), dem Griechischen, erkennen. Ohne die griechische Koine (Gemeinsprache) wäre also auch die Ausbreitung des Christentums nicht denkbar gewesen.
Kurzvortrag Religion
Sokrates und Jesus im Vergleich - Hellenisierung des Christentums
Gliederung:
1. Einleitung
2. Biografien
2.1 Sokrates
2.2 Jesus
3. Vergleich
4. Hellenismus
4.1 Allgemeine Definition
4.2 Hellenismus und seine Auswirkungen
4.3 Die Philosophie in der Zeit des Hellenismus
4.3.1 Die Epikureer
4.3.2 Die Stoiker
4.4 Andere Stimmen zum Hellenismus (Anhang)
5. Literaturverzeichnis
„Zauberer von Athen“ (Alkibiades)
„Den Sokrates zu loben, ihr Männer, will ich so versuchen: durch Bilder... Ich behaupte denn nun, dass er gänzlich ähnlich den Silenen ist, die da in den Bildhauerwerkstätten stehen, die die Künstler darstellen mit Schalmeien oder Flöten in den Händen und die, nach beiden Seiten hin aufgeklappt, im Inneren vorhandene Götterbilder sichtbar werden lassen. Und ich behaupte weiter, dass er dem Satyr Marsyas gleicht. Dass du nun wenigstens dem Aussehen nach diesen Gestalten ähnlich bist, Sokrates, dürftest du nicht einmal selbst bestreiten. Dass du ihnen aber auch sonst gleichst, höre hiernach! Du bist ein Schalk! Oder nicht? Wenn du es nämlich nicht zugibst werde ich Zeugen dafür bringen. Doch kein Flötenspieler? Ein viel wunderlicher noch als jener! Er bezauberte ja über Instrumente die Menschen, durch die Kraft, die von seinem Munde ausging... Du aber unterscheidest dich von ihm nur dadurch, dass du ohne Instrumente, mit bloßen Worten ebendies bewirkst“ (Symp. 215 a - c).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Arbeit zitieren
- Ria Winkelmann (Autor:in), 2001, Sokrates und Jesus im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106074
Kostenlos Autor werden
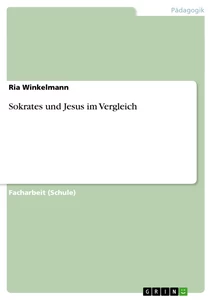
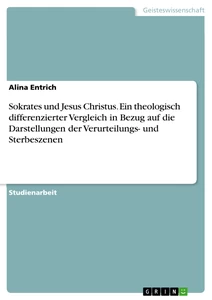
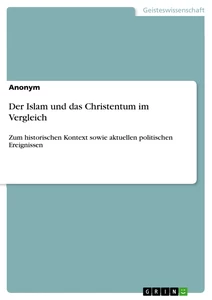
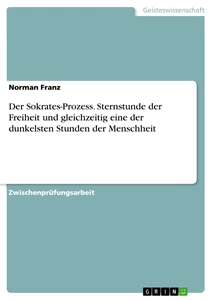
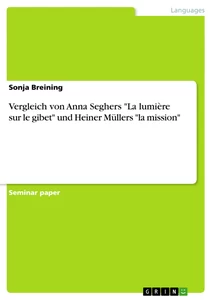
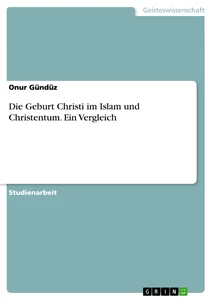

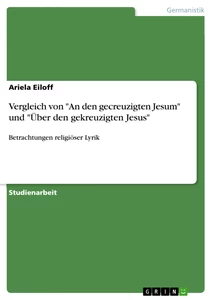
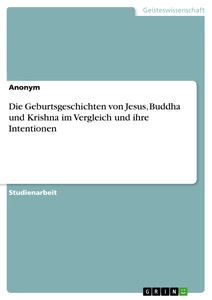

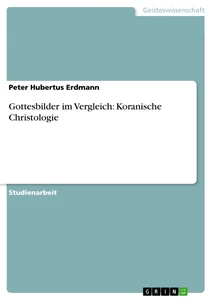

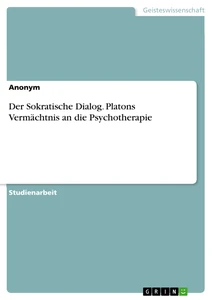

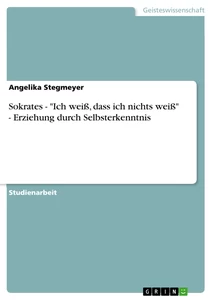

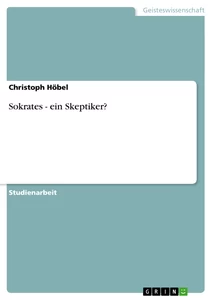
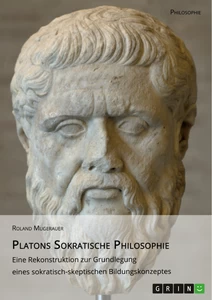


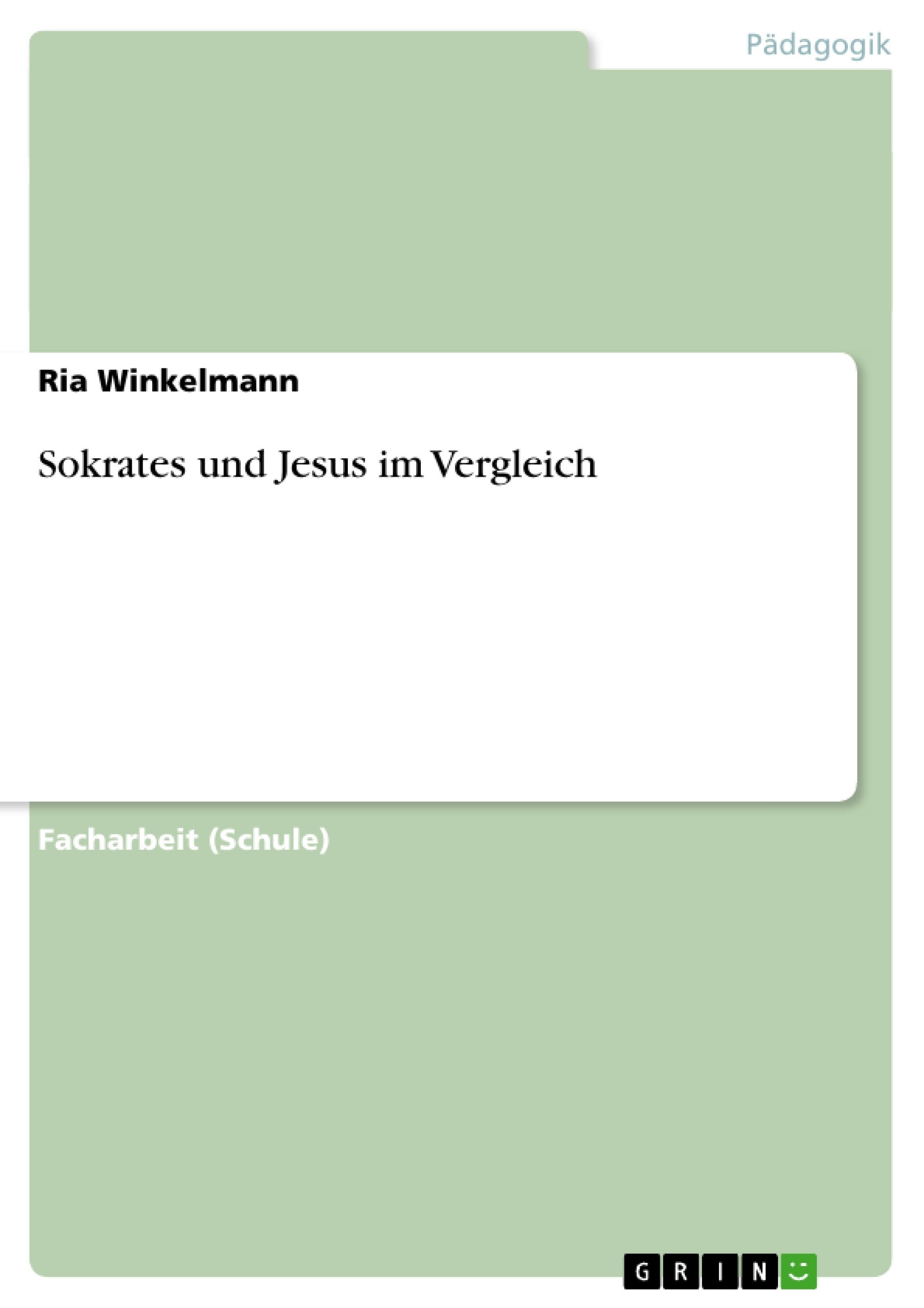

Kommentare